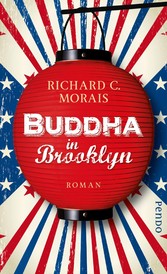
Buddha in Brooklyn - Roman
von: Richard C. Morais
Piper Verlag, 2013
ISBN: 9783492963565
Sprache: Deutsch
368 Seiten, Download: 2157 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
Das Leben eines Menschen ist wie ein Ball, der auf einem Fluss treibt, heißt es in den buddhistischen Schriften - gleich, was wir wollen oder wünschen, wir werden von einem unsichtbaren Strom mitgerissen, um schließlich in die grenzenlose Weite des schwarzen Ozeans gespült zu werden. Dieses Bild gefällt mir. Es besagt, dass es Zeiten gibt, in denen wir schwerelos auf der Oberfläche des Lebens treiben und uns träge von einem seichten Tümpel zum nächsten schwappen lassen. Doch dann, wenn wir es am wenigsten erwarten, geht es um eine Flussschleife herum, hinter der wir jäh einen tosenden Wasserfall hinabstürzen, in den aufgewühlten Abgrund, der sich darunter auftut. Genau diese Erfahrung habe ich gemacht. Und einige andere mehr. Auch wenn ich es kaum glauben kann: Meine Reise flussabwärts begann vor nunmehr sechs Jahrzehnten, als ich ohne viel Aufhebens in der Kleinstadt Katsurao geboren wurde, hoch oben in den Bergen der Präfektur Fukushima in Japan. Der Gasthof meiner Eltern lag nur acht Kilometer von dem neunhundert Jahre alten »Quelltempel« der Quellwasser-Ordensgemeinschaft entfernt, die dem Mahayana-Buddhismus angehört. Als ich auf die Welt kam, besiedelten die fünfzehntausend Einwohner dieser kleinen Handelsstation am Fuße des Mount Nagata noch die felsigen Flussufer des Kappa-gawa, der sich unterhalb des Städtchens in einer Reihe kleinerer Wasserfälle in die von Reis bewachsene Ebene stürzte. Der obere Teil des Ortes bestand aus drei Gewerbeeinheiten, die von einer Fußgänger-Einkaufspassage, einem kleinen Busbahnhof und einer Handvoll niedriger Apartmentgebäude begrenzt wurden. Letztere beherbergten auch ein Krankenhaus, das in den Fünfzigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts gebaut worden war. Darunter lag an den beiden Flussufern die Altstadt, deren schmale Gassen von einfachen Holzhäusern gesäumt waren. Ferner gab es ein paar Flachbauten mit kleinen Handwerksbetrieben - einen Schlosser, einen Holzschnitzer und einen Fischhändler -, die die Einwohner mit ihren Waren versorgten. Das Städtchen klammerte sich an die Uferhänge des tosenden Kappa-gawa, und die beiden Ortsteile waren durch zwei Steinbrücken miteinander verbunden. Jeden Tag begab sich unsere Nachbarin, die o-beinige Mrs Saito, zum mujinhanbai, einem herrenlosen Lebensmittelstand, dessen Besitzer auf die Ehrlichkeit der Leute vertraute, und legte für ihren Einkauf ein paar Münzen in die dafür vorgesehene Dose. Noch immer muss ich bei der Erinnerung schmunzeln, wie sie mit ihren Rüben und Kohlköpfen durch die schmalen Gassen nach Hause watschelte und wie eine Aufziehente über die untere Kopfsteinbrücke wackelte. Etwas Überirdisches lag über dieser aus Stein und Holz errichteten Kleinstadt an den felsigen Hängen des japanischen Gebirges. Nachts legte sich eine seidige Tauschicht auf die Dachziegel, die beiden Brücken und jeden Busch. Und sobald die ersten frühmorgendlichen Sonnenstrahlen die dünne Luft durchbrachen, löste sich der Tau auf und stieg als schwelender, rauchender Dampf auf, sodass es den Anschein hatte, als gehörten wir halb der diesseitigen und halb der jenseitigen Welt an. Der Gasthof unserer Familie hieß Lotusheim. Zu seinen Gästen zählten hauptsächlich die Pilger, die in unser abgelegenes Bergstädtchen kamen, um den Quelltempel zu besuchen. Mein Urgroßvater hatte das ryokan im neunzehnten Jahrhundert gebaut. Der Gasthof war eingezwängt zwischen die benachbarten Wohnhäuser, die sich dicht an dicht an den Rand der Felswand drängten. Jäh fiel sie zu dem Becken ab, das der Fluss an dieser Stelle bildete und das gleichzeitig als örtliches Schwimmbad diente. Das Haupthaus war durch einen kurzen, überdachten Durchgang mit einer Reihe kleinerer Nebengebäude verbunden, in denen Gästezimmer und Badehäuser untergebracht waren. Diese waren in den Zwanzigerjahren des neunzehnten Jahrhunderts hinzugefügt worden. Egal, in welchem Teil des Gebäudes man sich befand, ob bei Tag oder bei Nacht, stets konnte man dem Gemurmel des Flusses lauschen, das sich wie Beten anhörte. Als zweites von vier Kindern wurde ich zwischen meinem älteren Bruder Daiki und meinem jüngeren Bruder Yuji geboren, auf den unsere kleine Schwester Atsuko folgte. Die Privaträume unserer Familie lagen im hinteren Teil des Haupthauses und waren von bescheidener Größe. Wir verfügten über drei kleine Zimmer oben unter dem Dach und zwei größere im Erdgeschoss, die durch fusuma, Schiebewän-de aus Reispapier, abgeteilt waren. Die beiden Stockwerke waren durch eine steile Holztreppe miteinander verbunden, deren Stufen im Laufe der hundert Jahre von unzähligen Füßen ausgetreten worden waren. Unser Familienaltar befand sich im Erdgeschoss, und natürlich wurde, als die Zeit dafür gekommen war, ein Toshiba-Fernseher angeschafft und im oberen Stock aufgestellt. Hinter den Schiebewänden verbargen sich Kisten, in denen sorgsam Zeugnisse unserer Familiengeschichte aufbewahrt wurden - wie Großvaters Uniform der kaiserlichen Armee und der Hochzeitskimono meiner Urgroßmutter. Meine Mutter, Okaa-san, war der Fels in unserem Bergdasein. Jetzt, da ich mich an sie zurückerinnere, kommt mir wieder eine eiskalte Winternacht in den Sinn, in der ein Schneesturm wütete und ein grimmiger Wind heulend über die felsigen Bergkämme fegte. Doch in unserem Gasthof hatten wir es warm und waren geborgen. Ich saß malend am kotatsu, einem beheizten und mit einer Steppdecke umgebenen Tisch, unter die man die Füße strecken konnte. Im Zimmer roch es nach Tusche und nasser Wolle und eingelegtem Rettich. Meine Mutter kniete auf einer der Tatami-Matten, die den Boden des Zimmers bedeckten, und stillte die kleine Atsuko, die in die Falten ihres gelockerten Gewandes eingemummt war. In dem altmodischen Kerosinofen in der Ecke brannte ein helles Feuer, in dessen Schein das Gesicht meiner Mutter leuchtete. Okaa-san, eine treue Anhängerin der Quellwasser-Ordensgemeinschaft, lauschte den sanften Klängen von Shomyos - den von buddhistischen Mönchen gesungenen, melodiösen Sutras -, die leise aus dem kleinen Transistorradio in der Ecke kamen. Ihre Haut war weich und cremefarben wie Reis, und ihre Augen über den von blassem Rosa überzogenen Wangenknochen hatten einen sanften, losgelösten Ausdruck, als würde sie von dem an ihrer Brust saugenden Kind und dem rituellen Sprechgesang der Mönche an einen himmlischen Ort entführt, weit weg von dieser beschwerlichen Welt. Als ich mit dem Pinsel über das Papier strich, schlug meine Mutter plötzlich die Augen auf und kehrte in die Wirklichkeit des Gasthofs zurück. Sie erinnerte sich wieder, dass ich anwesend war, und lächelte. Dies ist eine meiner liebsten Erinnerungen. Und doch entsinne ich mich auch deutlich, wie unendlich erschöpft Okaa-san oft war. Denn zur Arbeit im Gasthof kamen ihre laut tobende Kinderschar und ihr labiler Mann. Meine Mutter hatte ein hitziges Temperament und eine scharfe Zunge, die gelegentlich die Oberhand gewannen. Außerdem hegte sie eine Vielzahl an Vorurteilen und Groll gegen andere. Ganz besonders verachtete sie die gaijin - Ausländer -, schon merkwürdig, wenn man bedenkt, dass sie einen Gasthof betrieb. Tief in ihrer Weltanschauung verankert, die sie an uns Kinder weitergab, war die instinktive Abneigung gegenüber Amerikanern, diesen stümperhaften Barbaren, die Japan aus unbegreiflichen Gründen besiegt hatten. Oft ereiferte sie sich darüber, wie sie unsere geliebte uralte Kultur zerstört hätten, über die Übel ihrer modernen technologischen Erfindungen und über den Konsumwahn des zwanzigsten Jahrhunderts, den sie eingeschleppt hätten. Die wenigen Amerikaner, die den Weg in unseren hoch in den Bergen gelegenen Gasthof fanden, schienen ihre schlimmsten Vorurteile nur noch zu bestätigen. »Sie riechen schlecht«, beharrte sie. »Wie Pferdefürze.« In lebhafter Erinnerung ist mir ein Morgen geblieben, als sie nach mir rief, während ich in dem kleinen Garten spielte, der eingeklemmt zwischen unserem ryokan und der Felskante über dem Kappa-gawa lag. Ich muss damals ungefähr neun Jahre alt gewesen sein. Die goldgestreiften Lilien standen in voller Blüte, und Rosenbauch-Schneegimpel plantschten flügelschlagend in dem mit Schnitzereien verzierten Vogelbad. Als ich nicht reagierte, rief meine Mutter erneut, eindringlicher diesmal, und ich legte meinen Stock ab und begab mich gehorsam zu den fusuma, die den Gästetrakt vom Haupthaus trennten. Nachdem ich meine Sandalen am Eingang abgestreift hatte, schlüpfte ich nach drinnen und ging den gebohnerten, abgedunkelten Flur entlang, als ein weißhaariges Paar in yukatas, Haus-Kimonos, aus seinem Zimmer trat. Es waren Mr und Mrs Nakamura, Pilger aus Kyoto, die jedes Jahr zum Beten und zur rituellen Reinigung in unseren Ort kamen. Als sie in mir den Sohn der Wirtsleute erkannten, grüßten sie mich höflich, ehe sie am Ende des Gangs in verschiedene Richtungen davonstrebten. Mr Nakamura bog nach rechts ab zu dem hinter Holzpaneelen verborgenen Badehaus für Männer, und seine Frau nach links in den Badebereich der Damen. »Okaa-san. Hier bin ich!« Mutter und nakai-san, unsere Putzhilfe aus dem Dorf, machten sich in einem Gästezimmer zu schaffen, das zum Fluss hin lag; sie rollten den Futon auf, staubten die Tatami-Matten ab und lüfteten den Raum. »Wo warst du?«, fragte sie ärgerlich. »Ich habe mich heiser geschrien nach dir. Geh und hol das Frühstückstablett der Nakamuras.« Als ich losging, um es zu holen, kam mir auf dem Flur gemächlich ein amerikanisches Paar entgegen - Touristen, keine Pilger. Sie waren in den Bädern gewesen und lachten laut. Die Frau war jung, blond und sehr schön, der Mann war im mittleren Alter, und sein nerzbraunes Haar war mit Silberfäden durchwirkt. Einen Moment lang blieben die beiden vor ihrem Zimmer stehen, wo meine Mutter noch immer herumfuhrwerkte, und spähten vorsichtig durch die Tür. »Hallo«, sagte der Mann freundlich - offensichtlich wollte er herausfinden, ob sie hineingehen durften. Wir starrten alle auf seine Füße. Er trug die hellgrünen Badeschlappen unseres Gasthofs. Im Haus. Jedes Kind wusste, dass man seine unhygienischen Badeschlappen niemals im Wohnbereich trug. Nie werde ich den Gesichtsausdruck meiner Mutter vergessen, als sie in unserem Dialekt zischte: »Was für Schmutzfinken! Man sollte sie den Berghang runterwerfen!« Meine Eltern waren typische Vertreter der im Zweiten Weltkrieg geborenen Generation: immer am Arbeiten, immer gehetzt, immer nur das Ziel vor Augen, das zusammengeschrumpfte Vermögen der Familie wieder aufzubauen. In meiner Erinnerung sehe ich beide stets mit gebeugtem Rücken: Vater, wie er vor den Gästen einen Diener macht, wie er sich über seine Werkbank neigt, während er eine Flurlampe neu verkabelt, oder wie er auf dem Dach kauert und zerbrochene Ziegel repariert; Mutter, die in ihrem blau-weißen Küchenkittel, ein Tuch um den Kopf gewickelt, in gebeugter Haltung Holz ins Feuer legt, über dem in Bambuskörben der Reis für mochi, Reiskuchen, gedämpft wurde, oder die Kieswege im Garten recht. Kaum war mein älterer Bruder groß genug zum Arbeiten, begann er ebenfalls diese familientypische Körperhaltung anzunehmen, wenn er zum Beispiel das schwere Gepäck der Übernachtungsgäste durch die Flure schleppte.
Kategorien
Kategorien
Service
Info/Kontakt










